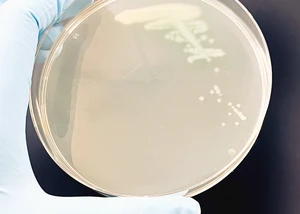COVIDOM+: Millionenförderung für Forschung zu COVID-19-Langzeitfolgen
Ratgeber Gesundheit & Lebenshilfe
Die bundesweite Studie COVIDOM+ unter Leitung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) und der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel erhält eine Förderung von 4,9 Millionen Euro, um die langfristigen gesundheitlichen Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf dem Post-COVID-Syndrom (PCS) im Vergleich zu anderen infektiösen Atemwegserkrankungen.

Die Vorgängerstudie COVIDOM hat gezeigt, dass nach der akuten COVID-19-Erkrankung häufig das Post-COVID-Syndrom auftritt. Dieses umfasst eine Vielzahl an Symptomen wie chronische Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Atembeschwerden und eingeschränkte Leistungsfähigkeit, die Betroffene im Alltag stark einschränken können. COVIDOM+ soll nun helfen, die Häufigkeit, Schwere und Langzeitfolgen von PCS besser zu verstehen.
Die Forschenden wollen herausfinden, wie Faktoren wie Infektionszeitpunkt, Impfstatus, Krankheitsverlauf und Vorerkrankungen die Entwicklung von PCS beeinflussen. Ziel ist es, unterschiedliche Ausprägungen zu erkennen und PCS von anderen postinfektiösen Erkrankungen wie dem chronischen Erschöpfungssyndrom abzugrenzen. Die Erkenntnisse sollen zur Entwicklung klinischer Leitlinien beitragen und die Versorgung der Betroffenen durch präzisere Diagnose- und Behandlungskonzepte verbessern.
Neben den gesundheitlichen Folgen untersucht die Studie auch die psychischen Folgen von COVID-19, um diese von anderen physischen und psychosomatischen Folgen der Pandemie abzugrenzen. Außerdem wird analysiert, ob PCS das Risiko für altersbedingte Erkrankungen erhöht und ob wiederholte Virusinfektionen beschleunigte Alterungsprozesse auslösen.
Methodik der Studie
COVIDOM+ baut auf der bereits etablierten, populationsbasierten COVIDOM-Kohorte mit 3.634 Teilnehmenden auf. Die Studie umfasst mehrere Nachuntersuchungen im jährlichen Abstand, um Veränderungen bezüglich des PCS-Verlaufs systematisch zu dokumentieren. Dazu werden umfassende Gesundheitsdaten und biologische Proben archiviert, die eine detaillierte molekulare und klinische Analyse ermöglichen.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist der Vergleich von COVID-19-Langzeitfolgen mit denen anderer Atemwegserkrankungen, insbesondere der Influenza. Die FRISH-Studie, die STAAB-Studie aus Würzburg und die NAKO-Gesundheitsstudie liefern hierfür wertvolle Vergleichsdaten.
Zusätzlich wird COVIDOM+ eng mit dem Exzellenzcluster Precision Medicine in Chronic Inflammation (PMI) verknüpft. Ziel ist es, die Grundlage für eine personalisierte Präzisionsmedizin zu schaffen, die den individuellen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht wird.
Finanzierung und Laufzeit
Die Studie COVIDOM+ wird durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mit insgesamt 4,9 Millionen Euro für die Projektjahre 2025 und 2026 gefördert. Die Finanzierung sichert die Fortsetzung der bis 31. Dezember 2024 laufenden COVIDOM-Studie.